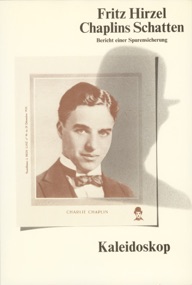Filmbuchhandlung Rohr, Zürich, 1982, Polaroid Elisabeth Neira
Chaplins Schatten
BERICHT EINER SPURENSICHERUNG
Der Tramp, die Erfolgsfigur? Er ist sein Schatten.
Er macht Chaplin populär, er folgt Chaplin
überall. Egal, ob er Hollywood neu aufmischt, im
Studio mit seiner Lolita-Liebschaft engste
Mitarbeiter verstört oder im Ersten Weltkrieg zur
Leitfigur aufsteigt.
Fritz Hirzel, Chaplins Schatten. Bericht einer
Spurensicherung. 472 Seiten, bebildert. Kaleidoskop,
Paperback, Zürich 1982.
Flyer-Leseprobe 1982: „Stellen wir uns den jungen
Chaplin vor, als er in Los Angeles 1914 in seine neue
Rolle schlüpfte: war er dem Underdog, den er
vor der Filmkamera spielte, in bestimmter Art verbunden?
Der düstere, autobiographische Hintergrund, von dem
später erst die Rede war: gehörte er nicht teilweise
zumindest in den Bereich einer publicityträchtigen Legende?
London 1889, im Geburtsjahr Chaplins: was war das
für eine Welt, die der Kleine vorfand – zu Hause, in den Strassen?
Die Elendsbezirke in South London: was bedeuteten
sie für Chaplin, waren sie wirklich die Stätten seiner Kindheit?
Und was war mit der Gegenwelt der Music Hall,
in der er den Vater, auch die Mutter hatte glänzen sehen?
Gibt es vielleicht Indizien dafür, dass seine Kindheit
um einiges normaler, gewöhnlicher womöglich verlaufen ist,
als Chaplin später selber es beschrieb?“
Medien „Ein gesuchtes Kultbuch“ Das Magazin
„Eine minutiöse Arbeit“ Tagesspiegel
„Handwerk des erbarmungslosen Zeilenschinders“ FAZ
„Spannend und unbedingt empfehlenswert“ Weltwoche
„Kaum ein Filmbuch, das filmischer wäre“ TagesAnzeiger
„Lesevergnügen“ Medien+Erziehung
„Umfangreiche Szenen- und Arbeitsfotos“ NDR
„Ungemein spannend“ Berner Zeitung
„Eine kleine Abenteuerfahrt“ Luzerner Neueste Nachrichten
Textanfang
Es regnete in Strömen, ein wattierter, grauer Nebelhimmel
verhüllte den Fernblick auf Savoyeralpen und Lac Léman.
In zwanzig Minuten war die Beerdigung, die in engstem
Familienkreis stattfinden sollte, in aller Stille abgewickelt, ein
Begräbnis, dem kaum mehr als dreissig Trauergäste
beiwohnten, Familienangehörige, engste Freunde, Hausangestellte
des Verstorbenen, eine spärliche, unter aufgespannten
Schirmen zusammengedrängte Trauergesellschaft. Hinter dem Leichenwagen ein Konvoi, in der Kolonne zwei Rolls Royces,
schwarze Limousinen, ein Mercedes, ein Kleinbus: so waren sie
von Manoir de Ban, dem mit einer dunklen, durch
Christbaumkugeln behängten Tanne im Park weihnächtlich geschmückten Herrschaftssitz, in ihren Autos losgefahren,
die Strasse zum Dorf hinunter, an der Kirche vorbei zum mit
Zypressen bewachsenen, winzigen Gemeindefriedhof
von Corsier sur Vevey. Ein paar Dutzend Zaungäste hatten
sich eingefunden, für die Pressefotographen waren
Sperrgitter errichtet worden. Es gab ein paar wenige, sich
auffallend gleichende Fotos vom Begräbnis, die von den
Agenturen verbreitet wurden und anderntags in den Zeitungen
zu finden waren. Stets stand in ihrer Mitte Oona, bleich,
müde, abgespannt, Witwe nun, sichtlich gealtert, mit leicht
verbittertem, abgehärmtem, durch eine dunkle Brille
halbverdecktem Gesichtsausdruck, mit einem Kopftuch angetan,
in Pelzmantel und Stiefeln. Mitgenommen sah sie aus, sehr,
sehr müde. Neben ihr Josephine, die zweitälteste Tochter, einen
Damenschirm in der Hand: langes Haar, dunkle Brille,
mit ersten Falten um die Mundwinkel herum, bald dreissigjährig inzwischen. Hinter den beiden, fast einen Kopf grösser,
durch Dazwischenstehende von ihnen getrennt, war Sydney
zu erkennen, ein Sohn Chaplins aus früherer, aus zweiter
Ehe, unter einem Schirm stehend, mit weissem, gepflegtem
Kinnbärtchen, das Gesicht gebräunt, fleischig. Bis auf
Geraldine, Oonas älteste Tochter, von der es hiess, sie sei
in Spanien durch Dreharbeiten zurückgehalten worden,
war die Familie vollständig versammelt. Oona zur Linken stand
Michael, ihr ältester, einst als Hippie gegen den Vater,
den Millionär, rebellierender Sohn: in kurzem Haarschnitt nun,
mit schwarzem Anzug und Krawatte. Obwohl Chaplin mit
der Kirche zeit seines Lebens nichts im Sinn gehabt hatte, waren
zwei anglikanische Geistliche aufgeboten worden, um ein
paar Gebete zu sprechen. Oona wartete gar nicht erst ab, bis
der Sarg in die Erde versank. Wozu auch hätte sie noch
ausharren sollen? Hatte sie ihren Mann nicht lange genug
versinken gesehen? Ein unter Wolldecken begrabenes,
pflegebedürftiges Gespenst, das mit Gemüse, Früchtekompott
und gehacktem Fleisch zu füttern war, ein Rollstuhlfahrer,
der wie ein Invalider herumgeschoben werden musste, ein
sabbernder Greis, der sich seit Monaten keinen Schritt
mehr fortbewegen konnte, nahezu paralysiert, als er 1977 am Weihnachtstag 88jährig um vier Uhr früh gestorben war,
die letzten Stunden offenbar im Koma liegend. Nachdem Oona,
seine Witwe, den Friedhof verlassen hatte, blieben für
die Pressefotographen nur einige der Jüngeren des Chaplinklans
im abgesperrten Bezirk zurück, um mit ein paar
Freunden reglos vor der offenen Grube zu stehen, in welche
der schwarzbedeckte Sarg hinabgesenkt wurde.
Das Grab glich einem einzigen, imgrunde fröhlich
wirkenden Blumenhügel, übersäht mit Dutzenden von Rosen,
roten vor allem. Aus den Blumengebinden schauten
die Schärpen ihrer Spender mit den letzten Grüssen. Circus Knie,
den Chaplin stets besucht hatte, winkte auf einem Band
„dem Freund und Vorbild” nach, das Personal von Manoir de
Ban, der Residenz, seinem „patron”, auch Gemeinde
und Société de Developement von Vevey waren mit Kränzen
vertreten und nicht zuletzt eine Familie Ivanovitsch:
„Dernière adieu à Charlot!” Spätestens hier aber drängen sich,
falls wir tatsächlich versuchen wollen, Chaplins Person
und Vita zu entmythologisieren, einige Fragen auf. Gab es
überhaupt irgendwelche Leute ausserhalb des
Herrschaftssitzes, die dem altgewordenen Chaplin, der die
letzten Jahre in zunehmender Isolation verbracht hatte,
noch ernstlich verbunden gewesen waren? Was wissen wir von
diesem Mann, der zuletzt ein Vierteljahrhundert in der
steuergünstigen Schweiz, in einer Art von selbstgewähltem Exil
verlebt hatte? Was war ihm geblieben aus den vier
Jahrzehnten seiner produktiven Zeit, die ihm drüben, in den
USA, beschieden gewesen waren, was von den Skandalen,
von den Pressekampagnen, die um seine politischen, um seine
sexuellen Aktivitäten herum entfacht worden waren? So oft
wir auch versucht haben, aus den Widersprüchen seiner Existenz
als Bürger, als Privatperson klug zu werden, ist eine
Frage letztlich unbeantwortet geblieben: Was ist er für ein Mann gewesen, was hat ihn umgetrieben, was hat ihn verfolgt
sein Leben lang? Zweifellos war er seit seiner Kindheit in South
London ein Mann mit vielerlei Gesichtern, doch den
Zeitgenossen, die sich jahrzehntelang die Legende vom Millionär
aus dem Armenhaus weitererzählten, genügte es
festzuhalten: ein genialer Mime, ein Filmkomiker, der grösste
von allen. Doch was immer aus dem Kino, diesem
Vehikel der Massenunterhaltung, inzwischen geworden war,
etwas, so schien es, stimmte bei Chaplins Begräbnis
nicht. Unter den Kranzgebinden kein Abschiedsgruss, der
wenigstens angedeutet hatte, dass hier ein Mann
begraben lag, der mit dem Film zu seinem Erfolg gekommen
war, zu schweigen davon, dass er in der Geschichte
nicht nur des Kinos zu den populärsten gehört hatte. Unter
den Trauergästen nicht einer, der einst in Hollywood
zu den Stars gezählt hatte. Kein Glamour, keine Prominenz,
kein Massenauflauf. Einziger offizieller Vertreter: der
britische Botschafter aus Bern. „No Hollywood pomp at Geneva
funeral of the baggy-trousered tramp”, titelte denn auch
der Daily Telegraph. Gewiss, sie hatten es so gewollt: eine stille Beerdigung im engsten Familienkreis. Nur können wir uns
fragen: Wären massgebend mehr gekommen, wenn sie es anders gewollt hätten? War es nicht eher so, dass ein Idol hier
seinen Zenit um einige Jahrzehnte überschritten hatte und zum
Fossil geworden war? Völlig durchnässt zogen um zwölf
Uhr mittags die letzten Fernseh- und Filmequipen aus dem Friedhof von Corsier ab, Leute aus dem Dorf kamen vorbei,
einfache Leute, ein Eisenbahnarbeiter, ein Briefträger, Hausfrauen,
ein älteres Ehepaar, Schulkinder. Ein neugieriger,
achtjähriger Bub blieb minutenlang im Regen stehen, sein
Haarschopf triefend, Turnschuhe an den Füssen. Alles,
was er von Chaplin kannte, war ein Film mit Charlot, den das Fernsehen zu Chaplins Tod gesendet hatte. Der Kleine
stand allein auf dem ausgetretenen, aufgeweichten Rasen vor
dem Blumenhügel des Grabes und fragte: „Liegt er nun
da unten mit seinem Schnauz und seinem Stock?” Ein Mythos
hatte seinen Schöpfer überlebt.
Natürlich war es nicht der Tramp, der in Corsier
oberhalb Vevey unter der Erde lag, nicht der kleine Mann mit
seinem Schnauz und seinem Stock: der existierte nur als
Schatten, als Gestalt auf der Leinwand, und war vor etlichen
Jahrzehnten dort zum letzten Mal in einem neuen Film
erschienen. Der Tote, dem auf dem Friedhof über dem Lac
Léman das vielzitierte, schlichte Begräbnis zuteil wurde,
war ein in luxuriöseste Umgebung eingebetteter, greisenhafter
Millionär gewesen, dessen Äusserungen die Mitwelt hätte
Zeichen eines Erinnerungsschwundes entnehmen können, längst
bevor er sich von der englischen Königin in den Ritterstand
hatte erheben lassen, um die ihm noch verbleibenden zwei, drei
Jahre als Sir Charles im Rollstuhl zu verbringen. Wäre
ein Nachfahre des Tramps, des Vagabunden je in Manoir de
Ban aufgekreuzt, er hätte die Portale des Herrschaftssitzes verschlossen gefunden. Chaplin, wenn auch ein Pflegefall zuletzt, zittrig, mit krankhaft aufgedunsenem Gesicht und
weissem Haar, hatte in einer anderen Welt gelebt, in einer
Welt der Hotelsuiten und der Bediensteten. Und doch
war es bezeichnend, wenn ihm bis zuletzt Attribute des Tramps
angedichtet wurden, bezeichnend für die Faszination,
die der Mythos des Tramps bei den Kinogängern noch immer
in Bewegung setzte. Von Chaplin sprachen die Leute
stets ein bisschen mit dem Schulterklopfen der Kollegialität,
die eigentlich dem Tramp, der Figur auf der Leinwand,
zu gelten hatte. Noch einmal verwischten sich die Konturen,
als die Zeitungen bei seinem Tod im Stil einer
Gebetsmühle die gewohnten Abziehbilder herunterleierten
und statt Sir Charles den Tramp begruben. „La Mort
du vagabond” titelte die in Genf erscheinende La Suisse,
ein Blatt aus der näheren Umgebung gleichsam.
„Charles Chaplin, The Immortal Tramp of International
Cinema, Dies At 88”: so stand es in Variety, dem
marktgerechten, jenseits des Atlantiks redigierten Branchenblatt.
„The Little Tramp Leaves the Stage”: das war die Art,
in der die New York Times die Nachricht überschrieb. Der Tenor
der Nachrufe: salbungsvoll bis versöhnlich, aber ohne
Inspiration, imgrunde gelangweilt, als gelte es, sich einer
müden Pflichtübung zu unterziehen. Nichts war vom
Enthusiasmus geblieben, mit dem die Intellektuellen einst
Charlie, die Leinwandfigur, entdeckt und begrüsst
hatten! Hatte Blaise Cendrars, der Schriftsteller, nicht einst
behauptet, die Deutschen hätten den Ersten Weltkrieg
verloren, weil sie Charlie nicht gekannt hätten? Unbestritten
ist gewiss, dass wir uns das Hinterland der Alliierten,
die Jahre der Schützengräben und des Fronturlaubs zu
vergegenwärtigen haben, wenn wir der Geburt dieses
Kinomythos auf die Spur kommen und erfahren wollen, vor
welchem Hintergrund die Figur des Charlie ihre
unheimliche Popularität erlangte.
Stellen wir uns jene Wochen, jene Monate vor, in denen
der Erste Weltkrieg nicht zuende gehen wollte, jene
Zeiten mit immer ungedeckterem Bedarf nach Ablenkung, nach Zerstreuung, jene verdunkelten Jahre, in denen die
Kinotheater sich gerade erst vom Odium der Stehbierhallen
befreiten, jene Stunden des aus den Zuschauerbänken
mit Spott und Hohngelächter übergossenen Hintertreppenromans,
der finsteren, von Klavierbegleitung untermalten Salon-
und Erbschaftsintrige, der ausser Atem geratenen Wirklichkeit
des Lebens auf der Leinwand, der Rührung angesichts
der Heldin des Melodramas, der im Widerschein der Handlung
feucht gewordenen Augen. In jener Umgebung war sie
erstmals aufgetaucht, die kleine, geradezu schamlose Gestalt
mit ihrem Schnauz, dem Stock und der Melone, war
aufgetaucht als ein Herumtreiber mit zweifelhaften Ambitionen
und hatte sich Zugang verschafft zu den Sympathien
der Kinogänger, die den watschelnden Gang mit Lachtränen
erwiderten, nicht zu reden vom Riesengelächter, wenn
der Dahergelaufene am Schluss den Hut zu lüpfen und Reissaus
zu nehmen hatte, auf einem Bein kurz um die Ecke
hüpfend. Eröffnet wurden die Programme, kaum noch einem Fanfarenstoss gleich, mit der jüngsten Ausgabe des
Journals der Kriegsberichterstattung, den immer hohler und ungeniessbarer gewordenen Erfolgsmeldungen von
der Front; dazu gab es Wochenschaubilder mit verwundeten
Soldaten, die eben in der Schweiz ankamen, Aufnahmen
aus einem Tuberkulosespital in den Bergen. Ihren
Erlebnishunger jedoch stillten die Leute im anderen, im
fabulösen Teil der Vorstellungen, die nicht mehr nur
aus unteren Schichten Zulauf hatten. Die Flucht aus der
Alltagswelt, hier war sie billig zu haben; und stets
sassen in den ausnehmend gut besuchten Vorstellungen
auch Soldaten, solche, die im Feld gewesen waren,
und solche, die ein Mädchen auszuführen hatten, bevor sie
selber an die Front mussten. Gab Charlie, dieser
Einzelgänger, diese lachhafte Verschränkung von menschlicher
Blösse und verzweifelt hochgehaltener Würde, nicht mit
einem Augenaufschlag, mit einem Schulterzucken zu verstehen,
dass die Welt ihm ungerührt den Buckel herunterrutschen
konnte? Wo immer Chaplin mit einem Einakter, einem Zweiakter
auf dem Programm stand, sprach es sich herum: hier
kam einer, der zum Lachen befreite, sagenhaft und ungeahnt
in seiner Wirkung. Von weither, aus unsichtbarer Ferne,
war er in jenen Wochen, jenen Monaten auf die Leinwand
gekommen, und doch erzählten die Kinogänger am
Ende des Ersten Weltkriegs von Charlie, diesem Wechselbalg
aus Hoch und Tief, als lebte er gleich um die Ecke,
mitten unter ihnen.
Die Erinnerung an Charlie, ans Gelächter und die
Begeisterung, die er einst bei den Massen wachgerufen hatte:
wo war all das geblieben? Und was hatte Chaplin, der
Millionär, damit zu tun, von dessen Begräbnis wir ausgegangen
sind? Als wäre seine Abdankung im Regen und dem Nebel
in den über dem Lac Léman ansteigenden Rebhängen irgendwie
doch zu geräuschlos verlaufen, kam es zu einem Nachspiel,
das dem Ganzen einen Zug ins Groteske, ins Makabere verlieh,
das dem Verstorbenen ebenfalls nicht fremd gewesen war.
Zwei im schweizer Exil lebende Osteuropäer hatten den Sarg aus
dem Friedhof gestohlen und sich vergeblich bemüht, für
dessen Rückgabe ein Lösegeld von 1,2 Millionen Franken zu
erpressen. lm frisch gepflügten Acker eines Maisfeldes,
eine halbe Autostunde vom Tatort entfernt, wurde der Sarg nach Verhaftung der Grabschänder gefunden und, nachdem
ein Präparator des Gerichtsmedizinischen Instituts der Universität
Lausanne ihn geöffnet und versichert hatte, die Leiche
Chaplins befinde sich in gutem Konservierungszustand, auf
dem Friedhof von Corsier zum zweiten Mal ins Erdloch
gesenkt, in welchem er nun allerdings einbetoniert wurde. Zwei Dilettanten, nicht besonders nervenstarke Amateure, die
über Nacht mit ihrem Coup ans grosse Geld zu kommen hofften,
hatten das stilvoll auf Bescheidenheit hin inszenierte Begräbnis
von Chaplin Lügen gestraft und trotzdem ihren Denkzettel erhalten:
so einfach war Geld auch nach dem Tod des Millionärs
aus Manoir de Ban nicht herauszubekommen.
Ein Mythos mit Hinterzimmern: in der Maske von Charlie
soll sich derselbe Mann verborgen haben, der auf dem
Friedhof von Corsier sur Vevey begraben wurde? Und wenn
dem so war, was hatte Chaplin damals, als er 25 Jahre
alt gewesen war, auf diesen genialen Einfall gebracht? Die Maske,
das schäbige Kostüm, sein Watschelgang und das Gelächter,
das durch die Kinosäle gegangen war: wie fern, wie entrückt, wie
geradezu unvorstellbar kommt uns diese Vergangenheit
vor, wenn wir von Chaplins Abdankung ausgehen! Etwas wie
das Staunen eines Ungläubigen: das scheint alles, was
uns von der populären Zeit des Kinos bleibt, in der die Fans
zu Tausenden zusammenströmten, um Charlie Chaplin,
den Mann aus Hollywood, zu sehen. Ausgelöscht, wie abgeschnitten
sind die Spuren der Erinnerung, die zurückführen in die
andern Tage einer Welt der Kinoindustrie, in die Geschäftigkeit
der Filmstudios, in welcher die Konturen der Gestalt mit
Schnauz, Stock und Melone sich entwickelten. Stellen wir uns
den jungen Chaplin vor, als er in Los Angeles 1914 in
seine neue Rolle schlüpfte: war er dem Underdog, den er vor
der Filmkamera spielte, in bestimmter Art verbunden?
Der düstere, autobiographische Hintergrund, von dem später
erst die Rede war: gehörte er nicht teilweise zumindest
in den Bereich einer publicityträchtigen Legende? London 1889,
im Geburtsjahr Chaplins: was war das für eine Welt, die
der Kleine vorfand – zuhause, in den Strassen? Die Elendsbezirke
in South London: was bedeuteten sie für Chaplin, waren
sie wirklich die Stätten seiner Kindheit? Und was war mit der
Gegenwelt der Music Hall, in der er den Vater, auch die
Mutter hatte glänzen sehen? Gibt es vielleicht Indizien dafür,
dass seine Kindheit um einiges normaler, gewöhnlicher
verlaufen ist, als Chaplin später selbst es beschrieb? Was sollen
wir von der Autobiographie, die er 1964 von Manoir
de Ban aus veröffentlichte, noch halten, wenn sich herausstellt,
dass bedeutsame Details der Beschwörung seiner
Armenhauskindheit einer genaueren Überprüfung nicht
standhalten? Beinahe sieht es so aus, als hätte der
alte Mann von seinem Herrschaftssitz über dem Lac Léman
aus nichts anderes getan, als die Legende seiner
Kindheit mit Szenen ausgemalt, die sich nachträglich als
unhaltbar, wenn nicht zum Teil gar frei erfunden
erweisen. Erinnern wir uns an seine Beschreibung des
tränenerfüllten Augenblicks, als seiner Mutter bei
einem Auftritt in der Music Hall die Stimme versagt, sodass sie
von der Bühne abtreten muss, während ihr Kleiner,
fünfjährig gerade, hinaustritt vor das Publikum, dessen
Sympathien er mit dem Song Jack Jones im Flug
erobert haben will: „Jack Jones, you’d know ’im / if you saw ’im /
’round about the market plyce.” Aldershot 1894: dies soll
für ihn der erste, für seine Mutter der letzte Bühnenauftritt gewesen sein. Nun, was sollen wir von dieser Geschichte halten,
wenn wir auf ein Theaterprogramm stossen, auf welchem Miss
Lily Chaplin, Serio and Dancer, zu entdecken ist: zwei Jahre
nach ihrem angeblichen Abgang von der Bühne, 1896 im
Hatgham Liberal Club? Oder nehmen wir die Szene, die Chaplin
vom Begräbnis seines Vaters schildert: die Familie sei so
abgebrannt gewesen, dass seine Mutter die Bestattungskosten
nicht hätte bezahlen können, doch plötzlich sei da ein
unbekannter, in Südafrika ganze Ländereien besitzender Uncle
Albert aufgetaucht, der das Geld für die Beerdigung
hingeblättert habe. Was folgt, hat middle class Format: ein mit
Satin ausgeschlagener Sarg, die Fahrt mit der Kutsche
zum Friedhof, Kränze, Blumen, die ins Grab geworfen werden.
Es genügt, die in Lambeth ausgestellte Todesurkunde
ausfindig zu machen, um Chaplins ganze Bestattungsgeschichte
zu widerlegen. Seinem Vater wurde offenkundig ein
Armenbegräbnis zuteil, eine letzte Reise ohne Zeugen, ohne
Trauergäste, vom Duft der Blumengebinde, vom
Pferdegetrappel der Kutschen nicht zu reden. Stattdessen
stellen wir fest, dass auf dem Dokument eine Adresse
von Chaplins Mutter festgehalten ist, die seiner Darstellung
nochmals zu widersprechen scheint:16 Golden Place,
Chester Street, Lambeth, das dürfte keine schlechte Adresse
gewesen sein in jenen Tagen. So bleibt die Frage:
Was war der Grund, uns solche fabelhaften Gespinste
zu erzählen? Oder, um endlich auf die eine, immer
wieder aufgeworfene Frage zu kommen: Warum ist in der Stadt,
in der Chaplin zur Welt kam, seine Geburtsurkunde nicht
aufzutreiben? Möglich, dass seine Kindheit anders verlaufen ist,
als wir bisher zu wissen glaubten. Trotzdem muss South
London, dieser Ausgangspunkt, ihm viel bedeutet haben. Warum
sollte er selbst noch Jahrzehnte später, als er im Carlton
oder Savoy abzusteigen pflegte, zu seinen Strassen, seinen Häuserzeilen immer wieder zurückkehren, wenn
die Erinnerung an die eigene Kindheit ihn derart bedrückte?
Anscheinend suchte Chaplin, der Millionär aus Beverly
Hills, in den Elendsbezirken von South London nach etwas, was
er verloren hatte. Auch wenn wir nicht soweit gehen
wollen, es gleich seine Seele zu nennen, so sah es doch für
seine Begleiter mindestens so aus, als suchte er nach
etwas, das hinter ihm lag. Es sah so aus, als hätte er auf der
Suche nach seiner Vergangenheit eine entfernte
Ähnlichkeit mit jenem Mann, der seinen Schatten verkauft hatte:
ein Schlemihl also? War er nicht zu Popularität, Prestige
und Vermögen gekommen, indem er die Gestalt mit Schnauz,
Stock und Melone, seinen Schatten, veräussert hatte?
Und hatte nicht auch er, wenn er nicht sogleich hatte erkannt
und belästigt werden wollen, nicht mehr unter die Leute
treten können?
In die Figur des kleinen Mannes, die innerhalb weniger
Jahre zum populärsten Mythos des Kinos geworden war,
hatte Chaplin die Erinnerungsbilder seiner Kindheit eingebracht, verklärte Bruchstücke aus dem Leben in den Strassen,
Häuserzeilen und Hinterhöfen, in denen er in South London,
dem Stadtrevier südlich der Themse, aufgewachsen war.
London, die im Aufbruch und Wandel begriffene Metropole eines
Imperiums, war Ende des neunzehnten Jahrhunderts
zur am dichtesten bevölkerten, zur expansivsten Stadt der Welt geworden. Beschleunigt wurde die rasche Ausbreitung
der Stadt durch das Aufkommen der Arbeiter-Eisenbahnzüge,
durch die erste Untergrundbahn, die Elektrifizierung
des noch mit Pferden betriebenen Tramverkehrs und durch
die Einführung der Autobusse. Aus London, der Stadt,
in welcher Chaplin aufwuchs, wurde die Welt, die Charles Dickens
vor fünfzig Jahren in seinen Romanen beschrieben hatte,
gründlich getilgt. Eine der Folgen der explosiven Stadtentwicklung
lag gerade in der Trennung der sozialen Klassen in
gesonderte Wohnbezirke, dies im Gegensatz zum London
des neunzehnten Jahrhunderts, das die verschlungene
Mischung einer City gewesen war, in welcher aristokratische
Stadthäuser und verslumte, überbelegte Behausungen
eng beisammen gelegen hatten. 1889, im Jahr, in dem Chaplin
geboren wurde, begann Charles Booth seine Studie
über Life and Labour of the People in London, ein bis zur
Jahrhundertwende auf siebzehn Bände angewachsenes
Werk, in welchem er aufgrund von Erhebungen die Feststellung
traf, dass jeder Bezirk seinen bestimmten sozialen
Charakter hatte. Immer weiter hatte der Mittelstand sich aus
der Stadt abgesetzt, mit der Welt der Arbeiterklasse kam
er nicht mehr in Berührung. Besonders in South London gab es,
was Verslumung, Wohnungsnot und Überbevölkerung
anging, einige Gegenden, die zu den dunkelsten Bezirken der
Stadt gehörten. Noch 1895, als Chaplin gerade sechs
Jahre alt war, sagte ein Vikar der anglikanischen Kirche über
South London: „Tödlich abgestumpft; eine Art Stauwasser
der Metropole, der undurchdringlichste Teil des Dickichts, in den
die Leute kommen um sich zu verstecken.” Allerdings gab
es in diesem South London zu jener Zeit auch honorige Adressen.
Zu diesen, nicht zu den verrufenen, gehörten die Häuser,
die Strassen, an denen Chaplin die ersten sechs Jahre seines
Lebens, die für ihn entscheidenden, die Verfassung seiner
Individualität prägenden, verbrachte.
Die Existenz, die Chaplin hier zunächst erlebte, war also
die einer recht behüteten, nicht zuletzt in gewissem
Wohlstand eingebetteten Kindheit. Seine Mutter konnte, als
sie noch Soubrette war und in der Music Hall auftrat,
es sich anscheinend leisten, an der Westminster Bridge Road
eine Wohnung zu mieten und für den Jüngsten ein
Kindermädchen einzustellen. So gab es, ehe das Versagen
der Stimme sie zum Abbruch ihrer Bühnenkarriere
zwang, vorerst eine Zeit, die insgesamt recht glücklich, zumindest
sorgenfrei gewesen war. Der kleine Chaplin, der
herausgeputzte Knabe dieser anderen, glücklicheren Tage, promenierte in Samtanzug und Samthandschuhen
neben seiner Mutter die Kennington Road entlang. Und sie,
diese zierliche, junge Frau, die mit den Männern Pech
gehabt hatte, war frei und auf sich selbst gestellt. Ein schönes,
im Ausdruck mädchenhaftes Gesicht blickt aus dem
Erinnerungsfoto, das Haar gelockt, mit aufgestecktem Hut- und
Schmuckaufbau, dazu hat sie einen ihre Zartheit
umhüllenden, dicken Wintermantel an. Von ihrem Mann,
dem Vater des Kleinen, einem robusten, in ernsten
wie heiteren Partien applaudierten Sänger aus der Music Hall,
hatte sie nun Ruhe; nach vier Jahren Ehe hatten sich
die beiden getrennt, einjährig war ihr Sohn, ihr gemeinsamer,
gewesen damals. Charles Spencer Chaplin, geboren
am 16. April 1889. Und sie, die Mutter, die seit der Trennung
allein erziehende? Erst 22 war sie gewesen, als sie ihn
geboren hatte, nicht als ihr erstes freilich, sondern als ihr letztes
Kind, ihr viertes. Und dann, nach der Trennung, hatte
sie dagestanden mit ihrer Bühnenkarriere und dem Kind, das
sie mit Sydney, dessen Halbbruder, bei sich aufziehen
wollte. Und wie gesagt: die ersten Stationen dieser Kindheit,
die für Charles, den jüngsten, bestimmenden, waren
wohlsituiert, vielleicht gar komfortabel; dem frühkindlichen
Leben fehlte es nicht an Geborgeneit, eine Kindheit
in den Slums, nein, das war dies alles nicht.
Dass sie in South London wohnten, in Lambeth,
um im Bezirk genau zu sein, wenn auch zunächst an bester
Lage, war für Bühnenprofessionals, die in der Music Hall
auftraten, nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Artisten gab
es hier jede Menge, auch Stars mit hoher Wochengage,
die einen aufwendigen Lebenswandel führten. South London war bekannt für seine Music Halls, für diese Freizeitpaläste
einer Arbeiterkultur, auf deren Bühnen ordinär vielleicht, aber
ohne Umschweife, ohne Zweideutigkeiten zum Ausdruck
kam, was die Arbeiter im Saal dachten und fühlten, aber nicht
artikulieren konnten. Für Charles war hier von Anfang
an die Welt, auf die sich die grossen Erwartungen bezogen. Hier
waren die Idole, die populären Stars, die Professionals,
die Karriere gemacht hatten, Leute, die im Quartier gleichwohl
von jedermann geschätzt, manchmal bewundert wurden.
Es war diese Welt, zu der seine Mutter gehörte, die Familie,
er selbst. Miss Lily Chaplin, so war sie im Programm
angekündigt, die einstige Lily Harley, Soubrette mit violett-blauen
Augen, geborene Hannah Hill, Tochter eines Schuhmachers,
eines der zahlreichen, aus Irland zugezogenen Unterklassigen.
War dies hier nicht ein Aufstieg, der sich sehen lassen
konnte? Doch täglich aus dem Bühnenlicht, aus dem Applaus
zu treten, nicht nur in distinguierten, mit barockem
Luxus verzierten Theatern, auch in lärmigen, zugigen Hallen
mit Tabaksqualm über den Tischen, dies alles: also
Ernährerin und zuhause Mutter, Fürsorgerin zu sein, das waren
zu gleicher Zeit verschiedene Rollen, vielleicht für eine Frau
wie sie zu viele. Der Zusammenbruch, der in Chaplins Kindheit
die Wende, den Abstieg in die Nähe des Dickichts brachte,
hatte sich seit längerem schon angekündigt. Zunächst hatte die
Soubrette, die zerbrechliche, die seine Mutter war, mit ihrer
Stimme Schwierigkeiten, gelegentlich erst nur, schliesslich aber
versagte ihr die Stimme mehr und mehr, immer mühsamer
wurde es für sie, zu Engagements zu kommen. So hörte sie denn
vorerst ganz auf, verliess enttäuscht die Welt der Music
Hall, nichts wollte sie mehr davon wissen, trat ins Gegenlager
über, wandte sich einer Kirchensekte zu, der Christ
Church, die in Lambeth von Reverend F.B. Meyer, einem
bekannten Baptistenprediger, geleitet wurde, und
versuchte, sich und die zwei Kinder mit Näharbeiten durchzubringen, die sie schlecht bezahlt, zuhause, in Heimarbeit verrichtete.
Was nun kam, war der Abstieg. Innerhalb weniger Monate rutschte die Familie Stufe um Stufe in schlechtere Quartiere
ab, bewohnte statt drei nun ein einziges Zimmer und erst noch
eines im Souterrain wie jenes an der Oakley Street.
Charles war sechs Jahre alt, als er die Niederungen zu entdecken begann, denen er bisher tunlichst ferngehalten worden
war, die Niederungen der Armut in South London. Die unerwartete Entbehrung, die Nachbarschaft des Elends auch, erfüllte
ihn mit Scham, mit Schrecken. In der Religiosität, der sich seine
Mutter zuwandte, fand er keinen Sinn; dazu hatte ihm die
Mutter zu Fabelhaftes in den Kopf gesetzt: ihre Bühnenlaufbahn
mit bis zu 25 Pfund Wochengage, zuvor ihr Jahr in
Südafrika mit geradezu fürstlichem Leben, aus dem angeblich
Sydney stammte. Wenn Charles aus den besseren
Tagen, den ersten sechs Jahren seines Lebens, eines in sich
aufgesogen hatte, so die Vorstellung, dass er zu
etwas Besonderem bestimmt war. Hatte die Mutter mit ihrem
Wunderknaben nicht kleine Nummern eingeübt, die er im
privaten Kreis, gelegentlich gar auf der Bühne zum Besten gab?
Hatte sie ihm nicht einen Song wie Jack Jones beigebracht,
dazu ein paar Tanzschritte, die Manieren besserer Leute; hatte
sie nicht versucht, ihm das Cockneyenglisch auszutreiben?
Nie würde er begreifen, warum sie von der Bühne abgetreten war;
er verehrte seine Mutter, aber er wollte sie auf der Bühne
der Canterbury Music Hall sehen, nicht unter den Reumütigen
der Christ Church an derselben Westminster Bridge
Road. Ihn verstörte dieser Rückzug, er fühlte sich verraten. Die
Erfahrung des Abstiegs machte ihm zu schaffen, mehr noch
aber das Gefühl, dass seine Mutter mit ihrer Kehrtwendung ihn
im Stich liess. Die nächsten Stationen, siebenjährig
wurde er inzwischen, waren Lambeth Workhouse, die Tore
des Armenhauses, die sich hinter ihm schlossen, und
wenig später, für mehr als ein Jahr, die Hanwell School for
Orphans and Destitute Children, eine ausserhalb
Londons gelegene Waisenhausschule. In dieser Zeit, während
der er sich mit Kindern aus den untersten Schichten in
die Anstaltsordnung einzufügen hatte, wurde seine Mutter
zum ersten Mal nach Cane Hill in die Irrenanstalt
überführt; mehr und mehr war sie bereits in den Monaten des
Abstiegs, als Charles und Sydney noch bei ihr gewohnt
hatten, in einen Dämmerzustand versunken; anscheinend ganz entrückt war sie aus dem Lambeth Workhouse nach Cane
Hill gekommen, von ihnen nun vollends getrennt.
Zwischendurch sollte Charles bei seinem Vater
unterkommen, zusammen mit Sydney wurde er dort abgegeben.
287 Kennington Road, das war eine Adresse an keiner
schlechten Lage in South London, zwei Zimmer, beide im ersten
Stock eines Backsteinhauses, eine Wohnung, in
die sie sich, falls alle, was selten vorkam, zuhause waren,
zu fünft zu teilen hatten, gemeinsam mit Louise, Vaters
Lebensgefährtin, und ihrem Kind. Ohnehin war dieser Vater,
als Charles aus dem frühkindlichen Leben auftauchte,
der grosse Abwesende gewesen; als er nun zu ihm in Obhut
gegeben wurde, konnte der kleine Charles sich nur
erinnern, den Vater bis dahin zweimal gesehen zu haben,
einmal in der Canterbury Music Hall auf der Bühne
und einmal auf der Kennington Road im Vorbeigehen. Hatte
seine Mutter ihm nicht vorgehalten, er werde in der Gosse
enden wie sein Vater, der ein Trinker sei? Trotzdem war er nun,
da er zu ihm zu wohnen kam, vom Vater, dem Schauspieler,
fasziniert, studierte und imitierte jede seiner Haltungen, erlebte
freilich auch, wie dieser Fremde, der sein Vater war,
nach Hause kam, um seinen Rausch hier auszuschlafen, wie
er aufbrausen und gewalttätig werden konnte. Dabei
hatte es dieser mit würzigen, populären Songs wie Eh! Boys?
und My Pal Jones aufgetretene Entertainer zu
Spitzengagen gebracht, ehe er sich im Alkohol auslöschte
und zerstörte. „Through the street we marched along, /
Singing ev’ry comic song –.” Bis zu sechs Zugaben hatten
die Music-Hall-Besucher bei My Pal Jones gefordert,
und was The Girl was Young and Pretty anging, so war ihm
erneut ein ungewöhnlicher Hit gelungen. „The girl was
young and pretty, / The masher was gay and old; / The girl was
very witty, / The man had lots of gold.” Mit vierzig Pfund
Wochengage war er in seinen guten Tagen erste Garnitur
gewesen, ein Star der Music Hall, dessen Konterfei ein
Musik-Verlag auf seine Notenblätter druckte. Und obwohl er
einige seiner populären Songs, etwa The Girl was Young
and Pretty, selbst geschrieben und komponiert hatte, schaffte
er es doch nicht, sich im Rampenlicht zu behaupten,
denn als er, mittellos inzwischen, ohne Bühnenengagements,
ein paar Jahre später an einer Leberzirrhose starb,
wie die meisten damals zu rasch verbraucht, war Charles Chaplin
senior, der trinkfeste Bariton, erst 37 Jahre alt.
Für Charles, der inzwischen wieder bei seiner Mutter
wohnte, erst hinter Kennington Cross zwischen Schlachthof und Hayward’s Konservenfabrik über einem Coiffeurladen
an der Chester Street, später in Pownall Terrace 3, im oberen
Stock eines düsteren Reihenhauses, hatte die Besichtigung
des Dickichts begonnen. Entlang der Kennington Road, um die
herum er die Häuserblocke und ihre Bewohner kennenlernte,
gab es Leute, die bei Doulton’s Töpfereien, andere, die bei der
Eisenbahn Beschäftigung fanden. Manche waren Arbeiter,
manche Handwerker in geregelter Stellung, dazwischen gab es
jene, die zu den ärmsten gehörten, Hausierer, Hafenarbeiter, Stadtstreicher, ein Haufen verlorener Existenzen. Es gab, wie
gesagt, Bühnenprofessionals hier, Inhaber gut geführter
Läden, Leute der Arbeiterklasse, aber auch Gelegenheitsarbeiter, Fuhrmänner, solche, die ohne das Notwendigste zu leben
hatten. Unter den Vermietern der Häuser eines andern, ebenfalls
an der Kennington Road gelegenen Blocks befanden sich
Handwerker, Angestellte, Vertreter, Beamte aus Eisenbahn und
Polizei, alle waren sie wohlsituiert, auch wenn ihre Mieter
erheblich schlechter lebten. Manche der kleineren Häuser entlang
der Strasse waren alt, oft dem Zerfall überlassen; bewohnt
wurden sie von Leuten, unter denen die meisten in Armut lebten,
einige gerade fähig, einfachste Arbeit zu verrichten, andere
allerdings ausgebildet, unter ihnen Mechaniker, Postangestellte
mit regelmässigem Einkommen. Es gab Häuserblocks, die
teils neu überbaut waren, teils noch aus Altbauten bestanden,
in denen Strassenhändler, Korbmacher, Busreiniger und
Holzhacker wohnten. Was die Sauberkeit dieser Leute anging,
so war der Schmutz, der sich täglich an ihnen neu
ansammelte, von jenem Dauerzustand leicht zu unterscheiden,
der mit dem Geruch des Tramps einherging, des
Vagabunden und Stadtstreichers, des verwahrlosten,
erinnerungslosen Gescheiterten, der abgestumpft,
in seiner Hoffnungslosigkeit zu keiner Reaktion mehr fähig
war. Sie alle gehörten zum Bild einer Welt, das der
junge Chaplin in South London aufnahm, einem Schwamm
gleich in sich aufsog, dieser Momentaufnahme einer
Kindheit, die er in der Dunkelkammer seines Unbewussten
verwahrte.
Mit staunenden Augen war Charles ins Dickicht
eingedrungen, in die Gegenwelt abseits der Durchgangsstrassen,
die wie das Netz einer Spinne den Bogen der Themse
markierten und Strassenzüge bildeten, die von den Flussbrücken ausgingen und in South London radial zusammenliefen, um
von den Kreuzungspunkten andere Strassenlinien auszusenden,
die sich in einer Irrwelt zu verästeln schienen und in den
Hinterhöfen endeten, wo Zerfall und Armut aus den Zimmern
überquollen. Eine Familie zum Beispiel, die mit vier
Kindern in einem einzigen Zimmer wohnte. Die Frau, eine arme,
geschundene, zerstörte Kreatur; der Mann, ein Trinker,
ein Kehrichtarbeiter, der dreissig Shilling die Woche verdiente.
Möbel waren keine da, ausser dem Rahmen einer
Bettstatt, einem alten Strohsack und einem Bettlaken; am
Boden lag ein Säugling, nur mit einer Jacke bedeckt;
der Vater sass im Pub um die Ecke und liess sich vollaufen.
Im Vergleich dazu gehörten die Häuser, die Strassen,
die Quartiere, in die es die Chaplins verschlug, nicht zu den
schlimmsten, nicht zu jenen, in welche die Polizei nur
ausrückte, wenn sie musste, und auch dann stets zu zweit; in
denen es Leute zu sehen gab, die ihre Verwahrlosung
in keiner Art mehr zu verbergen suchten; Frauen, die in vom
Strassenschmutz verdreckten Unterröcken umherschlarpten,
Tücher um den Kopf gewickelt; heruntergekommene
Männer, die in Seitenstrassen herumhingen; Frauen, die zu dritt,
zu viert auf einem Treppenabsatz tratschten, darunter
eine, die ihrem Säugling ungeniert die Brust gab; zerstörte
Gesichter in den Strassen, ein Knabe mit nacktem,
verdrehtem Bein; immer wieder Abbruchhäuser, überfüllte
Mietblocks, in denen sämtliche Schrecken eines
ausweglosen und zerstörerischen Lebens sich zu versammeln
schienen, düstere Gegenden, zu deren Bild Industrieanlagen
ebenso gehörten wie Betrunkene, die gewaltig sangen, wenn sie
in den Hinterhof eines Strassenhändlers wankten, wo
Brotrinden, Papier und Abfälle verstreut lagen und verschmutzte
Kinder in zerlumpten Kleidern, die entweder zu gross
oder zu klein waren, herumlungerten; zu schweigen von den
Kutschern, den Prostituierten, die sich an der Waterloo
Station, der Endstation der Eisenbahn, herumtrieben.
Nicht, dass der junge Chaplin sich in dieses Dickicht
verstrickt hatte, ihm genügten die Streifzüge, die Entbehrungen,
zu denen er nochmals gezwungen war, nachdem
seine Mutter zum zweiten Mal nach Cane Hill in die Irrenanstalt
gekommen war und er sich durchzuschlagen hatte, auf sich
gestellt, auf sich allein. Nicht, dass er unter den Verhältnissen
in South London Schaden genommen hätte in der Art,
dass er ihr Opfer geworden wäre, aber etwas muss ihm doch
geblieben sein, etwas wie ein Tiefenleck, ein seelisches.
Mit seiner Bühnenkarriere ging es rasch voran, wäre nur diese
Entfremdung nicht gewesen, dieses Gefühl, von seiner
Mutter im Stich gelassen zu werden. Nichts hatte die Tage seiner Kindheit, die für den l4jährigen im Tournéebetrieb und
im sich häufenden, gesparten Geld zuende gingen, neben den
grossen Erwartungen so sehr geprägt wie diese
Entfremdung. Was war inzwischen aus ihm geworden,
aus seinen Träumen, seinen Vorstellungen?
Damals, als er auf der Bühne Jack Jones gesungen hatte,
war er fünf gewesen; kaum zehn Jahre war er alt,
als er mit den Eight Lancashire Lads, dieser Kindertruppe aus Holzschuhtänzern, auf Tournée ging, einer der acht,
die sich im Clog Dancing produzierten, was gross in Mode
war gerade. Es folgten verschiedene, winzige Auftritte
im neuerbauten, mit Elefantenparaden und Bathing Beauties
im Wasserbecken aufwartenden Riesentheater des
London Hippodrome, dem späteren The Talk of the Town,
unter anderem als Darsteller einer Katze in Cinderella,
der Weihnachtspantomime, bevor er mit 14 in Sherlock Holmes
als Billy, der Zeitungsausträger, zu einer richtigen
Bühnenrolle kam, einer Sprechrolle, mit welcher er drei
Jahre lang auf mehreren Tournéen auch im Norden
der Insel unterwegs war, aus dem Koffer lebte, äusserst sparsam,
zurückgezogen, wie gesagt, als Halbwüchsiger im Tross
von Erwachsenen, aber bereits mit einer Wochengage, die sich
sehen lassen konnte und ihn jedenfalls den anderen
gleichstellte. Noch keine 17 Jahre alt hatte er es immerhin
soweit gebracht, dass er im Who is Who on the Stage
für 1906 aufgeführt war und einen Agenten hatte. Natürlich,
neben dem berühmten William Gillette auf der Bühne
zu stehen, das war schon ein Erfolg, aber etwas anderes
war ihm ebenfalls aufgegangen, etwas Neuartiges,
Bezauberndes, das Marie Doro hiess, eine junge Bühnenschönheit,
in die er sich auf der Stelle verliebte, heimlich, ohne
es ihr zu sagen, natürlich.
Das Theater, die Music Hall, sie hatten ihn nun ganz.
Es folgte der Schritt in ein neues Fach, herunter aufs Terrain der Charakterkomik, einer grelleren Imitation des Lebens mit
in der Music Hall zum Lachen freigegebenen Charaktertypen, ein Prestigeverlust für jemanden aus der gehobenen
Westendtheaterwelt. Hatte Chaplin bisher Rollen gespielt,
die ihm angeboten worden waren, so begann er nun,
seine Rollen, seine Charaktere selber zu gestalten. In Casey’s
Court Circus wurde er zur Zugnummer einer Revueburleske,
indem er den stadtbekannten Doktor Walford Bodie imitierte, einen
Quacksalber, der in den Londoner Strassen Menschenmengen
anzog, wenn er sein Wundermittel für einen Shilling pro Flasche verhökerte. Das Engagement, zu dem Sydney für ihn
am 26. Mai 1906 den Vertrag unterschrieben hatte, war
bei einer Wochengage von zweieinviertel Pfund
zustandegekommen, „at a salary weekly of two pounds and
five shillings.” Sydney, sein Halbbruder, der erst zur See
gefahren war, schaffte es, bei Fred Karno unterzukommen, dem
Grossunternehmer in Sachen Slapstick Comedy; und
endlich gelang es ihm, auch Charles dort einzubringen. Der
Betrieb von Fred Karno’s Companies, das muss man
versuchen sich vorzustellen, war in dieser letzten Blütezeit der
Music Hall ein Nervensystem professioneller Bühnenkomik,
eine Zentralwerkstatt für Unterhaltung und Gelächter. Karnos Büro
in Camberwell bildete nicht umsonst den Ausgangspunkt
für immer neu zusammengestellte Bühnenensembles, die oft zu
gleicher Zeit mit derselben Burleskshow die ganze Insel
und die halbe Welt bereisten. Die grotesken Sketche waren die
Summe dessen, was Slapstickburleske und Music Hall
zu bieten hatten. Sie mochten rüde sein, oft waren sie treffsicher,
und darauf kam es an; nicht selten stand ein mit allen
Wassern gewaschener Komiker im Vordergrund, im übrigen
gehörte, was der Truppe auf die Reise mitgegeben
wurde, meist zum erprobten, sozusagen feuersicheren Material
an Gags und Situationen. Es war eine bizarre, vielleicht
plebejische Schule des Entertainments, der Tradition der britischen Pantomime entwachsen, derbe, handfeste, sprich:
schlagfertige Komik, rührselig mitunter, mit grausamem
Humor und akrobatischem Witz, mit Songs, mit
Jonglier- und Tanzeinlagen. Den ersten Erfolg in diesem
Puzzlegefüge der Repertoires und Routiniers buchte
Chaplin im zweiten Anlauf, 1908 an der Seite von Harry Weldon
in The Football Match, der Slapstickburleske um einen
Fussballtorhüter, an den sich ein Schurke heranmachte, mit
der Absicht, ihn zu bestechen natürlich. 14 Wochen
wurde der Sketch im London Coliseum gegeben, bevor die
Truppe damit in die Provinz ging, auf eine Tournée
hinauf bis nach Nordirland, wo die Rivalität zwischen Chaplin
und Weldon, die offenbar von Anfang an bestanden
hatte, vollends zum Ausbruch kam. Chaplin, der den Schurken
gab, holte sich seine Lacher auf eigene Faust, aber Weldon
in der Haut des dummdreisten Torhüters war engagiert als Star
des Sketches, als Hauptfigur. Und mochte Chaplin auch
in London scheitern, als er in der reputierten Oxford Music Hall
die Rolle Weldons hätte übernehmen sollen, anhaben
konnte diese Niederlage ihm wenig. 1909 spielte er die Rolle
des ehemaligen Konkurrenten trotzdem, allerdings auf
einer anderen Bühne; inzwischen war er bei Fred Karno selbst
zum Star einer Tournéetruppe geworden, wenn auch
einer anderen.
Trotz dieser Engagements, dieser Tournéen, die sich
nun fast lückenlos folgten, hatte Chaplin etwas wie eine
Privatwelt aufgebaut, die in seinen Augen den Aufstieg greifbar,
sichtbar werden lassen sollte. Eine neue Adresse war
zu beziehen, ein Heim mit Polstergarnitur. Gerade erst 19 war
Charles gewesen, als dieser Umzug stattgefunden hatte,
dieser Auszug aus den Niederungen von Lambeth. Mit Sydney
zusammen hatte er eine Wohnung mit vier Zimmern
genommen – stadtauswärts, in der feineren Gegend der Brixton
Road, Glenshaw Mansions 15, dort, wo sie zu zweit
nun ihr Boudoir genossen, wenn sie einmal gemeinsam in
London waren, eine Plüschwelt mit türkischen
Teppichen, einem maurischen Wandschirm, roten Lampen
und einer Staffelei, auf der ein weibliches Aktgemälde
stand, von einem Goldrahmen eingefasst. Das war seine
Privatwelt, als er Hetty Kelly kennenlernte, seine
erste Liebe, das amerikanische Revuegirl, das er ungestüm
erobern wollte, möglichst gleich in zwei, drei Stunden.
Es blieb im Fall von Hetty Kelly bei einem Flirt, denn sie, die
er unter Bert Coutts’ Yankee-Doodle Girls entdeckt
hatte, war sehr unbestimmt geblieben, zu plötzlich kam ihr alles.
Nicht nur, dass sie erst 15 war, aufschlussreicher
mochte sein, wie auffallend sie seiner Mutter glich, gerade
dem Bild aus früheren Tagen, das er von ihr in sich
bewahrte. Gerade weil diese eine Liebe, seine erste, ein
uneingelöstes Versprechen bleiben sollte, schien
Hetty Kelly das geeignete Objekt seiner Verklärung zu sein.
Dass sie ihn abgewiesen, ihn (um mit Chaplin, dem
verbittert-selbstmitleidigen, zu reden) sitzen gelassen hatte,
liess ihm noch Jahre später anscheinend keine Ruhe.
Nein, seine Hetty, die bald in New York bei ihrer mit einem
Millionär verheirateten Schwester lebte, blieb, aus
welchen Gründen immer, für ihn bis zuletzt unangetastet, eher
stets ein Fantasiegebilde als irgendeine Wirklichkeit.
Immerhin war sie die erste jener Kindfrauen, auf die er es
zeitlebens abgesehen haben sollte, an die er sich in
seiner Art heranzumachen pflegte, romantisch, überstürzt, um
Mitleid heischend und zugleich besitzergreifend. Mochte
er im übrigen protzen, wie sehr er wollte, mochte er die Allüre
des jungen, arrivierten Snobs zur Schau tragen, als hätte
er hinter dem Imponiergehabe eine unbestimmte Ängstlichkeit
zu verbergen, mochte er seine Enttäuschungen in
Bordellbesuchen ertränken und nicht bloss den harten Kerl herauskehren, wenn es um seine Laufbahn und seine
Gage ging, in seiner libidinösen Fixierung auf nymphenhafte
Geschöpfe, die mit ihm den Sündenfall erleben sollten,
blieb er sich sozusagen treu.
Es war vor allem eine Rolle, mit der Chaplin bei
Fred Karno bekannt wurde, und das war die Rolle
des Betrunkenen, der in Mumming Birds eine Music Hall
besuchte, im Frack, mit weisser Binde aus seiner
Loge gestikulierte und in die Vorstellung eingriff, die mit
The Saucy Soubrette, als die Amy Minister vors
Publikum trat, mit Bunco the Magician, The Terrible Turk
und mit dem Quartett der Village Choir Singers,
zu dem Arthur Stanley Jefferson gehörte, über die Bühne
ging. Ein Stück Selbstverulkung also, deftigstes
Theater im Theater, das Karno mit seinem Starkomiker Fred
Kitchen zusammen geschaffen hatte, ein Sketch in drei
Szenen, der sich allerdings bereits seit vier Jahren im Repertoire
hielt, nachdem ihn Karno zunächst mit Billy Reeves in der
Hauptrolle herausgebracht hatte. Irgendwie schien es aber, dass
erst Chaplin dem Betrunkenen, der sich zum Schluss
mit einem Freistilringer anlegte, zu einer Resonanz verhalf,
in der die Doppelbödigkeit der Szene ganz aufbrach
und jede der Unflätigkeiten, mit denen der Betrunkene sich
den Artisten vom Parkett aus widersetzte, in Sturmwellen
des Gelächters unterging. Es war diese umwerfende Rolle, mit
welcher Chaplin in der Folies Bergère auftrat, als Fred
Karno 1909 die Truppe für einen Monat nach Paris schickte.
Auch war es dieses Stück, das Max Linder, der Star der
Filmkomödie bei Pathé, kurz darauf in Max au music hall verfilmte, vermutlich, nachdem er Chaplin in der Rolle des
Betrunkenen gesehen hatte. Und nochmals, im Herbst 1910,
als Chaplin mit Fred Karno’s Company New York erreichte
und erstmals in Amerika gastierte, war es dieses Stück, das seinen Erfolg begründete, nachdem die Tournée mit dem aus London
verordneten The Wow-Wows, einer wortreich-versponnenen
Burleske über Geheimgesellschaften, beinahe gescheitert wäre. Allerdings trug Mumming Birds, die Burlesque Show,
die der Truppe gestattete, ihre Amerikareise auf über ein Jahr
auszudehnen, hier einen anderen, neuen Titel, A Night
in an English Music Hall. Hier wussten die Theaterbesitzer,
was sie ins Haus bekamen: „Always a Hit”, „Always a
Great Big Act”! Auf der Bühne, schrieb 1911 die Winnipeg
Tribune, in der Rolle eines angewidert aus der Wäsche
stierenden Betrunkenen, sehe Chaplin aus, als hatte er mindestens
35 Jahre auf dem Buckel; jede kleinste Regung seines
verwandlungsfähigen Gesichts, und sei es nur das Anheben
einer Augenbraue, habe im Publikum unkontrollierbare
Ausbrüche von Gelächter zur Folge. Es war der Erfolg dieses
einen Stückes, wenn Chaplins Name auf der Tournée
über Chicago in den Westen nach Kalifornien und San Francisco
bald grossgeschrieben am Theatereingang stand. Und
sosehr dies alles mit Music Hall zu tun hatte, so öffnete sich
hier für Chaplin doch die Tür zum Film. Nicht nur, dass
er seinen Bühnenhit in A Night in the Show 1915 selbst verfilmen
sollte, irgendwie hatte zuvor schon der Umstand, wie er
zum Film Zugang fand, mit dieser Rolle des Betrunkenen zu tun.
Denn damals in New York, als A Night in an English
Music Hall im American Theatre gegeben wurde, sass
in einer der Vorstellungen Mack Sennett, bald ein
Grossproduzent von Slapstick Comedies, der Chaplin
nach Los Angeles holen sollte.
Und Amerika? Was hat Amerika Chaplin gebracht?
Zunächst im privaten Bereich, eine Enttäuschung: er hatte Hetty
Kelly, die wieder zu sehen er insgeheim gehofft hatte,
nicht getroffen. Und beruflich? Mit übergrossen Erwartungen
war er aufgebrochen, mit nicht geringer Scheu auch,
der Angst, er könnte nicht genügen. Aber welche Haltung
er auch einnahm, die des Eroberers, der eine Welt
zu gewinnen hatte, die des Eingeschüchterten, der seiner Sache keineswegs sicher war, gerade im schwankenden,
rasch wechselnden Hoch und Tief seiner Gefühle lag eine
der Eigenschaften, die zu kultivieren er sich besonders
ins Zeug legte, erst auf dem Schiff, später in den Hotels und
auf der Eisenbahn. Vielleicht, dass er mit dem Gehabe
des Exzentrikers nur etwas auslebte, was für ihn selbst nicht
zu durchschauen war. Er, der vor den Bühnenkollegen,
unter denen Arthur Stanley Jefferson mitreiste, der spätere
Stan Laurel, bald im elegantesten Anzug aufkreuzte,
herausgeputzt wie ein Dandy, mit Derbyhut, Handschuhen
und Spazierstock, war handkehrum derselbe, der sich
mit Violine und Cello, die er die längste Zeit quer durch den
Kontinent mitschleppte, während Stunden zurückzog,
sich launisch von den anderen absonderte, bald die Haare
nicht schneiden liess und in schäbigster Kleidung
herumlief. Bereits der Unterschied zwischen Bühnenfigur und Privatmann war für Besucher nicht selten verblüffend.
Im Empress Theater von Kansas City, an der letzten Station
ihrer Tournée, soll eine Frau, nachdem sie hinter der
Bühne einen Blick auf den abgeschminkten, wirklichen Chaplin
hatte werfen können, sich entrüstet haben: „Really, it’s
a shame; such a nice-looking young fellow, too.” Was Chaplin
selbst anging, so hatte Amerika gerade erst begonnen,
ihn zu entdecken. Volle Häuser, enthusiastische Kritiken, die
den Star gebührend hervorhoben – „a real comedian”,
„one of the not-too-many funny men”! Mit anderen Worten:
in Amerika war Chaplin kein Unbekannter, kein Niemand
mehr. Die andere Frage war: Hatte er noch Boden unter den
Füssen, hatten sie ihn nicht zu hoch hinaufgetragen?
Zusehr war Chaplin von Grund auf Schauspieler, als dass
er seine seelische Verfassung nicht in einer Rolle hätte
ausdrücken müssen. Denn was ihn stets von neuem zu bewegen schien, während er etwa am Fenster eines Zugsabteils
die Weite des Horizontes absuchte, war die Frage, die ihn eines
Tages mit einem Schaudern erfüllen sollte, wenn er an
den eigenen, schwindelerregenden Aufstieg dachte: Wo lagen
die Grenzen, die dieses Land ihm setzte? Amerika
würde, das begann ihm damals vielleicht zu dämmern, alles
in den Schatten stellen, was er sich erwarten konnte.
Und als er im Gefühl des neugewonnenen Selbstbewusstseins
1912 noch einmal nach Europa zurückkehrte, so gerade
für ein halbes Jahr. Seine Mutter wollte er nicht sehen, regelte
nur mit Sydney, der inzwischen geheiratet hatte, ihre
Überführung in eine private Nervenheilanstalt; erst nachdem
er eine Tournée zu den Kanalinseln und nach Frankreich
hinter sich gebracht hatte, stattete er seiner Mutter einen Besuch
ab und ergriff die erste Gelegenheit, die sich ihm bei Fred
Karno bot, um mit A Night in an English Music Hall und weiteren
Shows im Dezember 1912 nach Amerika zuriickzukehren.
Diese Amerikatournée von 1913, die Ende November erst,
einmal mehr mit letzter Station in Kansas City, zuende gehen
sollte, hatte Chaplin noch nicht einmal zur Hälfte absolviert, als er
von Mack Sennett, dem Direktor der Keystone Company,
das Angebot erhielt, Ford Sterling zu ersetzen, den Komikerstar
der Slapstickfilme, die Sennett produzierte. In ihrem New
Yorker Büro offerierten Kessel und Baumann, die Teilhaber der
Keystone Company, Chaplin 150 Dollar Anfangsgage
die Woche, mehr als das Doppelte dessen, was er bei Fred
Karno in der Music Hall zuletzt verdiente. Und mochte
Chaplin auch mit dem Film noch nicht allzu viel im Sinn haben,
die Unterschrift, die er unter den Vertrag mit Keystone
setzte, liess den Rest seiner Amerikatournee zur Pflichtübung
werden. Immerhin, es war Mitte Dezember geworden,
als Chaplin 1913 die Studios der Keystone Company aufsuchte,
rund fünf Kilometer von Downtown Los Angeles entfernt,
an der Ecke zwischen Glendale Boulevard und einem ansteigenden Weg, der Allessandro Road, gelegen inmitten einer Gegend
von Wohn- und Industriesiedlungen, die erst noch im Entstehen
waren. Und was das Studioareal anging, das Mack Sennett
1912 hier übernommen hatte, um mit einer eigenen Produktion
zu beginnen, so passte es nicht schlecht in diese Gegend.
Hier hatte Sennett, der inzwischen 34 war, eine Formel für die
Filmkomödie entwickelt, die bei den Kinogängern sogleich
auf Zustimmung gestossen war. Die Slapstickfilme, die er drehte, Einakter, die eine Viertelstunde dauerten, waren nicht
zimperlich, mit Zusammenstössen, die von brutaler Komik sein
konnten, stets auf Tempo aus, auf Action, auf Bewegung.
Sennett, der selbst als ziemlich grob gebauter Bursche in seinen
Filmen aufzutreten pflegte, war unter dem Namen Michael
Sinnott in Kanada geboren, ein gelernter Kesselschmied, war in
Burlesque Shows Statist gewesen, bei der Biograph Statist
auf dem Drehgelände. Nicht nur das Handwerkliche, auch die Vorstellung dessen, was Kino tatsächlich sein konnte, hatte
er dort unter D. W. Griffith, diesem ersten, grossen Regisseur,
der seine Melodramen von Film zu Film eindringlicher
gestaltete, mitbekommen.
Dies alles war für Chaplin, der bestenfalls mit vagen Vorstellungen in den Film einstieg, sozusagen Neuland.
Der erste Eindruck hätte zweideutiger nicht sein können. Chaplin
war inzwischen 25, aber er sah, wie Sennett plötzlich
meinte, zu jung aus für die Rollen, die er hier spielen sollte.
Und da er, der die Nummer eins sein sollte, zugleich
der Neuling war, den Sennett für das grosse Geld geködert
hatte, ging es nicht ohne den üblichen, bei Verträgen
dieser Art aufgewirbelten Staub der Missgunst ab. Nicht, dass
er sich hätte fremd vorkommen müssen, die meisten der
Komödianten, die bei Keystone auf der Plattform standen, kamen
aus der Music Hall. Ungewohnt war Chaplin vielmehr die
Arbeit vor der Kamera selbst; den Anfänger verwirrte, dass die
Szenen nicht in ihrer Reihenfolge zu filmen waren, sondern
Drehplatz um Drehplatz, quer durch die Handlung hindurch; nicht zuletzt fühlte er sich überfahren von der Hektik, zu der hier
alles angetrieben wurde. So konnte es nicht verwundern, wenn
er mit Henry Lehrman, dem Regisseur von Making a Living,
seinem ersten Film, gleich hintereinander geriet. Hinzu kam nun allerdings, dass er Lehrman, der ihn nicht einfach aus Neid
zur Schnecke machen konnte, zu wenig entgegenzusetzen hatte,
vor allem nicht, was das wichtigste gewesen wäre, eine Figur,
die auf Anhieb überzeugt hätte. Chaplin erschien als aufgeblasener Geck in hellem Gehrock, mit Zylinderhut, Monokel und
langem, nach unten gezwirbeltem Schnauz – eine fremde Gestalt,
die sich in Making a Living abzappelt als Hochstapler, der
Bilder und Notizen klaut, die ein Reporter beim Verkehrsunfall mit einem Sterbenden gemacht hat. Dies alles, wohlverstanden,
nachdem dieser Halunke sich erst Geld beim Biest von Reporter ausgeborgt und ihm hernach die Verlobte ausgespannt
hatte. Dieser erste Film, Chaplins Debüt von 1914, galt auf dem
Platz, da war man sich bei Keystone einig, als Rohrkrepierer; verkneifen wir es uns also, am Beispiel dieses distinguierten
Schurken, dem alle Mittel recht sind, die Moral der Erfolgreichen
allzu sehr entblösst zu sehen. Zu bizarr war diese Gestalt,
zu englisch im Kostüm, zu bühnenhaft; zu krude der ganze Film,
in welchem Henry Lehrman nicht nur Regie führte, sondern
gleich auch den Reporter spielte, mit dem sich Chaplin zu prügeln
hatte. Seltsam aber wäre es zugegangen, hätte sich bei
Lehrman, als er Sennett das Debakel zu rapportieren hatte,
nicht Schadenfreude in den Ärger eingeschlichen, dies
umso mehr, als Lehrman die Keystone Ende Februar mit Ford
Sterling verlassen wollte, um mit ihm für die Universal
eigene Komödien zu drehen.
Sennett, der nicht die Spur einer Anteilnahme erkennen
liess, musste nach diesem Film zur Überzeugung gelangt
sein, mit Chaplin den falschen Mann engagiert zu haben, ein
Fehlgriff, der seinen schwungvollen Umsatz sehr bald
empfindlich stören konnte. In Amerika war die Keystone, was
Filmkomödien anging, marktbeherrschend; allein für 1913
hatte sie eine Produktionsliste vorzuweisen, die weit über 100 Titel umfasste, eine Zahl, die 1914 um einiges übertroffen
werden sollte, und dies, obwohl Sennett nun mit Zweiaktern
beginnen wollte, mit Komödien also, die eine halbe
Stunde dauern konnten, aber entschieden mehr Zeit zur
Vorbereitung erfordern würden. Und nun also,
gleich zu Beginn solcher Ambitionen, dieser Fehlstart,
diese Missstimmung, diese Unzufriedenheit; dabei
konnte der Unterschied zu dem, was Chaplin bei Fred Karno
in der Music Hall getan hatte, keinesfalls gravierend
sein. Dinge, die er absolut beherrschte, Dinge wie Timing
und Improvisation, waren auch im Film von nicht zu
unterschätzender Bedeutung. Und sein Befremden angesichts
der Verfolgungsjagden, die Mack Sennett zu seinem
Markenzeichen erhob, wirkte wenig überzeugend. Filme hatte
es nicht nur im Kino zu sehen gegeben, auch in der
Music Hall waren sie nicht selten ein Teil des Programms
gewesen, gerade Slapstickfilme zum Beispiel; Chaplin
hätte also bekannt sein müssen, was ihn bei Keystone erwartete.
Was überhaupt das Filmemachen, den Gedanken dazu
anging: so unvertraut konnte er Chaplin nicht sein, hatte er selbst
doch Alf Reeves, Karnos Manager in Amerika, auf die
Möglichkeit angesprochen, einen Kameramann zu engagieren,
um Karnos Bühnenstücke abzufilmen. Warum nun, wo
Chaplin mittendrin stand, diese Entfremdung? Wenn es wirklich
zutraf, dass er nun, in dieser neuen Umgebung, den
Leuten bei Keystone zu verstehen gab, er wolle bei Sennett
nichts als rasch Geld verdienen, persönlich halte er Filme
für minderwertig, so tat er dies, als glaubte er, seinen Abschied
aus der Music Hall rechtfertigen zu müssen, und er tat es
so, als wäre das Angebot, Filme zu machen, in seinem Fall etwas
sehr Ungewöhnliches gewesen. Das aber war es
sicher nicht. Wenn wir bedenken, wie sehr der Film zur alles überschwemmenden Unterhaltung wurde, wie sehr
er Leute brauchte, immer neue Gesichter, so war das Angebot
von Sennett nicht unerwartet gekommen, nicht für den Hauptdarsteller einer Truppe bei Karno. Wie auch immer, nach dem
gescheiterten Debüt liess Sennett den neuen Mann in seinem
Zweifel hängen, und Chaplin suchte selber weiter.
Drei Equipen arbeiteten zu gleicher Zeit im Studio;
eine mit Ford Sterling, dessen Stelle in ein paar Wochen Chaplin einnehmen sollte, eine zweite mit Fatty Arbuckle, dem
wendigen Schwergewicht, und eine dritte mit Mabel Normand,
der unbestrittenen Heroine der Komödienwelt bei
Keystone. Hier, auf der dritten Plattform, war unter den
aufgespannten Musslintüchern, die das Sonnenlicht
verteilen sollten, die Szenerie einer Hotelhalle aufgebaut.
Gedreht wurde Mabel’s Strange Predicament, ein
Durcheinander im Hotel, bei welchem Henry Lehrman die Regie
nicht nur mit Mack Sennett, sondern ebenso mit Mabel
Normand zu teilen schien, die selbst zu inszenieren anfing.
Es war während der Dreharbeiten zu diesem Film,
dass Chaplin zum ersten Mal in der Figur erschien, die seine Berühmtheit begründen sollte, in der Figur mit Schnauz,
Stock und Melone. In diesem, seinem ersten Auftritt kreuzte
er als Betrunkener auf, der in der Hotelhalle telefonieren
will und feststellt, dass er kein Geld bei sich hat. Dann tritt Mabel
mit einem Hund an der Leine in die Hotelhalle. Charlie
verwickelt sich in ihrer Leine, fällt zu Boden und bleibt an einem Spucknapf hängen. Und doch, wie peinlich dieser
Zusammenstoss auch sein mag, Charlie gibt sich verzweifelt
Mühe, sich die Blösse nicht anmerken zu lassen und
an etwas festzuhalten, das er für seine Würde hält. Auf dem
Drehplatz löste dieser erste Auftritt, was gewiss eine
Seltenheit war, unter den Versammelten spontan Gelächter aus.
Und wenn auch die Frage, ob Chaplin diese neue Gestalt
nach durchwachter Nacht, nach reiflicher Überlegung, durch
Planung also geschaffen oder ob er sie im Gegenteil aus
dem Augenblick heraus, durch Zufall und Intuition gefunden hatte,
auch wenn diese Frage sich nie eindeutig klären liess,
so blieb doch die bedeutsame Feststellung, dass die Silhouette
dieses kleinen, heruntergekommenen Kerls mit den
zu weiten Hosen, dem zu engen Veston wie aus einem Wurf
heraus hier nun plötzlich vor uns stand.
Und trotzdem war es nicht etwa so, dass Chaplin
mit diesem Film in seiner neuen, bald sehr populären Figur
erstmals öffentlich zu sehen gewesen wäre. Etwas sehr
Gewitztes, für die Produktionsverhältnisse bei Keystone Typisches
kam dazwischen. Während der Dreharbeiten zu
Mabel’s Strange Predicament entstand kurzerhand ein
anderer, vollkommen improvisierter Streifen, der
schliesslich zwei Tage früher herauskam. Diese äusserst
amüsante Kleinigkeit erschien auf einer Spule mit
Olives and their Oil, einem Dokumentarfilm, und hiess
Kid Auto Races at Venice. Der Film, der keine sechs
Minuten dauerte, war in Los Angeles an der Strandpromenade
von Venice, südlich von Santa Monica, gedreht
worden, während ein authentisches Seifenkistenrennen
für Kinder stattfand.
(...)